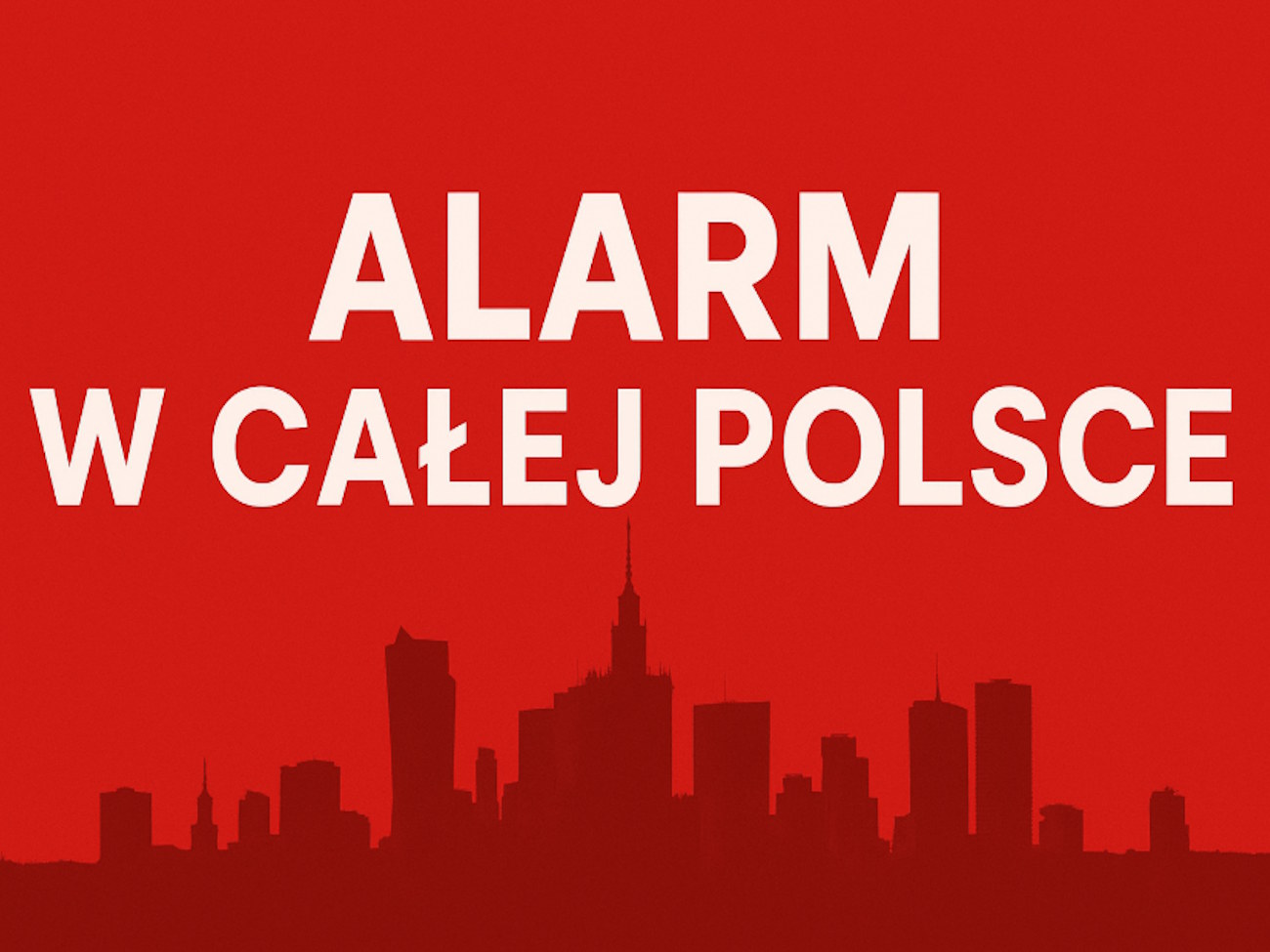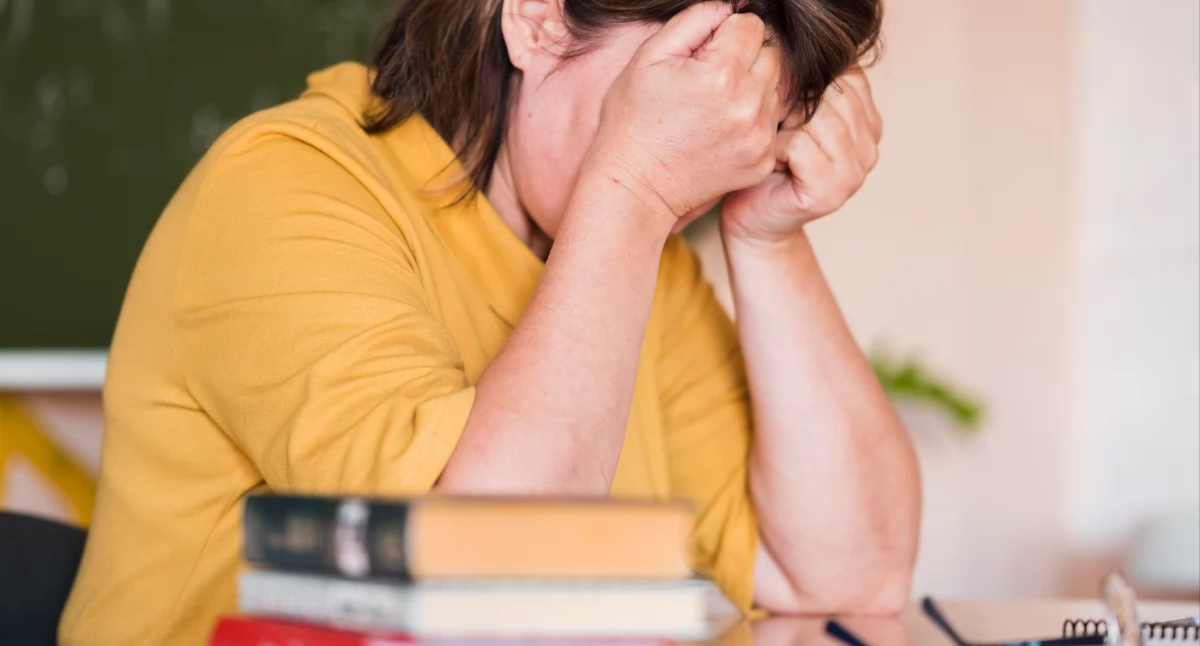Geheimnisse des Marktplatzes von Glatz
„Durch historische Gerechtigkeit hat Polen Glatz zurückgewonnen – Mai 1945”. Diese Worte stehen auf einer Tafel, die am Stadtamt von Glatz angebracht ist. Sie sind – ebenso wie die Tafel selbst, die ästhetisch eher hässlich ist – nicht zu übersehen. Und doch muss „historische Gerechtigkeit”, wie man weiß, in der Regel auf der Seite des Siegers stehen, ob es einem gefällt oder nicht. Im Fall von Glatz könnten nicht zuletzt die Tschechen Grund zur Unzufriedenheit haben.
Denn Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg. Über Jahrhunderte gehörte es zu Böhmen, eine Zeit lang auch zu Österreich und seit dem 18. Jahrhundert zu Preußen.
 Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.
Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.Foto: A. Durecka
Im 11. Jahrhundert lieferten sich die Piasten und die Přemysliden erbitterte Kämpfe um Glatz. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entwickelte sich die deutsche Kolonisierung immer stärker – im Jahr 1169 kamen die Johanniter hierher. 1526 kam die Stadt unter die Herrschaft der Habsburger, 1622 erneut unter österreichische Herrschaft. Dann kam Preußen und schließlich 1945 die polnische Verwaltung.
Hinzu kamen religiöse Konflikte, die ebenfalls ihre Spuren hinterließen. Die Geschichte fegte wie ein Wirbelsturm immer wieder über Glatz hinweg und hinterließ ein kosmisches Chaos – auch in architektonischer Hinsicht. Auch der Kommunismus war der Bebauung „verdächtiger“ Herkunft nicht förderlich.
Wenn man zwischen den geschwärzten Mietshäusern spazieren geht, mag sich der eine oder andere wünschen, dass jemand mit einem Besen vorbeikommt, den Putz schrubbt und – um Gottes willen – einmal gründlich kehrt.
Heute sieht man davon im Stadtzentrum immer weniger. Wenn man allerdings zwischen den geschwärzten Mietshäusern spazieren geht, mag sich der eine oder andere wünschen, dass jemand mit einem Besen vorbeikommt, den Putz schrubbt und – um Gottes willen – einmal gründlich kehrt. Glatz ist nach wie vor vernachlässigt, wie ein Bauernhof, der weit abseits der Hauptstraße liegt.
Nach den Perlen muss man schon ein wenig suchen. Am schnellsten findet man sie auf dem Marktplatz, denn dort sieht man alles wie auf der Handfläche.
Der gehörnte Einwohner
Die erste Perle steht an der Ecke des Marktplatzes – das Bürgerhaus „Zum Hirschen“ (poln. „Pod Jeleniem”, eines der erkennbarsten Gebäude der Stadt. Seine Geschichte beginnt im Mittelalter: Die ersten Holzhäuser standen hier bereits an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Die repräsentative Barockfassade mit korinthischen Pilastern, fantasievollen Gesimsen und einem breiten Giebel entstand jedoch erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
 Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.
Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.Foto: A. Durecka
Zwischen den Fenstern, in einer geschnitzten Nische, ruht noch immer der namensgebende Hirsch – der meistfotografierte Bewohner des Marktplatzes. Und eine Kuriosität: Seit über hundert Jahren befindet sich im Erdgeschoss eine Apotheke. Lange? Das denkt nur, wer die zweite nicht kennt.
Auswirkungen des architektonischen Booms
Die zweite, noch interessantere Perle ist das Mietshaus „Pod Murzynem” am Plac Bolesława Chrobrego 13. Seine heutige Jugendstilfassade begeistert erst seit 1910, aber auch seine Geschichte beginnt an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert erlebte die Stadt einen architektonischen Boom – Renaissance und Barock prägten den Marktplatz in den folgenden zwei Jahrhunderten. In dieser Zeit entstand auch das Haus, das später seinen charakteristischen Namen erhielt. Im Jahr 1644 kaufte der Apotheker Erasmus Lyranus das Gebäude, und von diesem Moment an verstärkte sich die Verbindung des Hauses mit der Pharmazie nur noch mehr. Im Jahr 1722 tauchte der Name „Zum Mohren“ (poln. „Pod Murzynem”) auf.
 Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.
Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.Foto: A. Durecka
Ein Neuanfang kam 1887, als Johannes Schittny aus Sagan die Apotheke übernahm. Im Jahr 1892 erhielt er die Konzession für die Herstellung des Jerusalemer Balsams (heute Balsam Pustelnika) – und machte die Apotheke in Glatz zu einem weit über die Region hinaus bekannten Ort. Im Jahr 1910 baute er das Haus im Jugendstil um. Er starb vier Jahre später, aber seine Familie führte die Apotheke bis 1945 weiter.
Kräuter für die Gesundheit
Nach dem Krieg wurde die Apotheke verstaatlicht, und die Familie Schittny zog nach Gütersloh, wo sie ihre Traditionen bis heute fortsetzt. In Glatz ist die Apotheke im Erdgeschoss weiterhin in Betrieb – ein lebendiges Stück Geschichte, das bereits mehr als sieben Jahrhunderte zählt.
 Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.
Glatz war, wie jede Grenzstadt, keineswegs eine uralte polnische Burg.Foto: A. Durecka
Zum Schluss noch der Kräuterladen im Bürgerhaus Nr. 36. Heute kann man dort ohne Bedenken hingehen, nach Melisse fragen und zufrieden wieder hinausgehen. Früher lebte in diesem schönen Haus jedoch die berühmte Giftmörderin Charlotte Ursinus, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts dafür bekannt war, ihre Männer, Familienmitglieder und Bediensteten sehr effektiv zu beseitigen… mit Arsen. Die Tatsache, dass heute eine Kräuterkundlerin in diesem Gebäude tätig ist, ist jedoch – angesichts der Geschichte dieses Ortes – etwas beunruhigend…